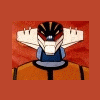Pastoral: Hide And Seek (US-Video)
Als internationaler Alternativtitel für diesen Film wird in der IMDb auch der aussagekräftigere PASTORAL: TO DIE IN THE COUNTRY angegeben. Unter einer Pastorale versteht man ja für gewöhnlich die idyllisierte Darstellung einer Natur, in der Mensch und Tier einträchtig miteinander existieren. Die Welt als Gottes Streichelzoo, gewissermaßen. Das Idyll bei Shuji Terayama ist ein trügerisches. Während Flora und Fauna dem pastoralen Ideal durchaus nahekommen und prachtvoll fotografiert sind, wirken die Menschen darin fast wie Fremdkörper. Es geht um einen jungen Mann, der zusammen mit seiner Mutter in einem sehr streng wirkenden Haus lebt und meistens in einer faschistischen Tracht herumläuft. Die Mutter merkt, daß der Junge langsam flügge wird und sie zu verlassen droht. Dies versucht sie zu verhindern. So weit die grundsätzliche Handlung. Dargestellt wird das im Film mit einer Mischung aus traditioneller japanischer Theatertradition, dem europäischen absurden Theater und einigen Ausflügen in den Surrealismus. Man fühlt sich manchmal erinnert an Fellinis Spätwerk und an Jodorowskys wütende Bilderwelten. Und doch wirkt die Darstellung des Menschen bei Terayama merkwürdig verzagt, fast resignativ. Beim Betrachten hatte ich stets den Eindruck, daß ein übermäßig kopflastiger Mensch in seinen Gefühlen herumstochert und etwas verzweifelt ist, daß er so wenig damit anfangen kann, ohne wirklich den Finger auf das persönliche Defizit legen zu können. Dieser Eindruck sollte sich im weiteren Verlauf des Werkes als gegenstandslos erweisen, aber immer langsam. Im direkten Umfeld des Elternhauses, nahe des „Scary Mountain", auf dem nur Ausgestoßene und Orakel zuhause zu sein scheinen, befindet sich auch eine Art japanischer Nationalzirkus, vollgestopft mit Japanflaggen, in dem innerlich wie äußerlich verwachsene Menschen beheimatet sind. Einige von ihnen sind auch getürkt, wie etwa die „Dicke Dame", die in einer aufblasbaren Hülle aus Plastik wohnt, die sie nicht abnehmen darf. Ihr Ehemann, ein Zwerg, pumpt sie regelmäßig auf mit einer kleinen Handpumpe, was ihr Luststöhnen entlockt. Sie hintergeht den Zwerg gelegentlich mit dem Kraftmenschen des Zirkus, der aber schließlich aus Eifersucht die Handpumpe wegwirft. Beide Männer behandeln sie wie den letzten Dreck, was sie aber mit lächelnder Langmut erträgt. Im Zirkus wie außerhalb des Zirkus scheinen die Menschen darauf fixiert zu sein, einander wehzutun, einander zu demütigen.
So weit, so gut. Nach etwa der Hälfte der Laufzeit bricht der Film auf einmal ab und entpuppt sich als Arbeitsmaterial eines Filmregisseurs (=ein Alter Ego Terayamas), der das Werk seinen Investoren zeigt. Er weiß nicht, wie er diesen Film über seine Jugend weiterführen soll, mißtraut seinen eigenen Motiven, seiner Erinnerung. Er taucht in seinen Film ein, betrachtet die verdichtete Welt seiner eigenen Erinnerung. Seine Betrachtungen teilt er mit seinem 20 Jahre jüngeren Selbst, wobei beide Versionen Terayamas an die Grenzen ihres jeweiligen Horizontes stoßen. Der ältere Mann fragt sich, ob er in der Lage ist, die Gegenwart zu verändern, indem er sein fiktives gegenwärtiges Ich seine Mutter im Film umbringen läßt, in dem er sich nun selbst befindet. Ich verrate nicht, ob ihm dies gelingt, aber ich möchte schon einmal andeuten, daß der Film mit einer der außergewöhnlichsten Tee-Szenen der Filmgeschichte endet...
War ich vom Anfang des Filmes nur mäßig beeindruckt, so saß ich gegen Ende völlig baff vor dem Fernseher und staunte Bauklötze. Von Terayama (der ja primär ein Theaterregisseur und Schriftsteller war) hatte ich bislang nur seine beiden französisch koproduzierten „Kommerzfilme" gesehen (FRÜCHTE DER LEIDENSCHAFT mit Kinski und den Episodenfilm COLLECTION PRIVEES) sowie sein extrem schwer zu schluckendes Frühwerk EMPEROR TOMATO KETCHUP, das von dem formenden Einfluß von Politik und Sexualität auf Kinder handelt und in seiner gestalterischen Drastik an Arrabals Aufschrei VIVA LA MUERTE erinnerte. PASTORAL verbindet auf unerhörte Weise die Darstellung einer beschädigten menschlichen Gemeinschaft mit einer Rückführung auf die Wirklichkeitswahrnehmung des Einzelnen. Wie nehmen wir die Gegenwart wahr und wie verläßlich sind unsere Erinnerungen, aus denen sich diese Gegenwartswahrnehmung herleitet? Wie sehr bauen wir selbst an unserer Gegenwart mit? Der autoreflexive Teil von PASTORAL deutet an, daß wir unsere Erinnerungen ständig selbst gestalten, wie ein Künstler, der an seinem Kunstwerk feilt. Aus der Wucht der Erschütterungen, der Verletzungen, ergeben sich all die fiktiven Miniaturen, aus denen sich unser Selbstbild zusammensetzt. Jeder Mensch ist im Grunde ein Künstler, sein Leben ein Kunstwerk, das er nach eigenem Gusto formen kann, wenn die Narben in seinem Gewebe das zulassen. Während Jodorowsky seine surreale Welt mit Grotesken anfüllt, die für meinen Geschmack das Anliegen des Künstlers eher verklausulieren, den Zugang eher erschweren, bleibt Terayama dabei ganz direkt. Er schreckt in einzelnen Szenen nicht einmal davor zurück, seine Poesie aufzuschlüsseln und sich so ganz direkt an sein Publikum zu wenden (z.B. in den Ausführungen des fiktiven Regisseurs über das Zeit-Paradoxon seines Vorhabens oder überhaupt in dessen inneren Monologen). Die Bilder sind ebenfalls direkt, arbeiten vorwiegend mit Formen und Farben, etwa über komplett eingetönte Einstellungen, die die Signalwirkung von Farben verwenden. Die Symbole sind trotz des gequälten Charakters des Menschenbildes eher spielerisch, z.B. die Assoziation von Geschlechtsverkehr mit dem Aufpumpen der Frau mit Luft oder dem Einfangen von Zeit in einer Uhr, die im Elternhaus des jungen Protagonisten aufgrund eines Defektes ständig schlägt. Der Regisseur innerhalb des Filmes gelangt schließlich zu einer Entscheidung. Ob es eine resignative oder eine schöne Entscheidung ist, muß jeder für sich selbst entscheiden. Ich hatte jedenfalls nur anfänglich Angst davor, einer Luftnummer aufzusitzen. PASTORAL halte ich für einen prachtvollen, einen großartigen Film, von dem ich mir sehr wünschen würde, daß ihn jemand in einer angemessenen Form wiederveröffentlicht!
Als internationaler Alternativtitel für diesen Film wird in der IMDb auch der aussagekräftigere PASTORAL: TO DIE IN THE COUNTRY angegeben. Unter einer Pastorale versteht man ja für gewöhnlich die idyllisierte Darstellung einer Natur, in der Mensch und Tier einträchtig miteinander existieren. Die Welt als Gottes Streichelzoo, gewissermaßen. Das Idyll bei Shuji Terayama ist ein trügerisches. Während Flora und Fauna dem pastoralen Ideal durchaus nahekommen und prachtvoll fotografiert sind, wirken die Menschen darin fast wie Fremdkörper. Es geht um einen jungen Mann, der zusammen mit seiner Mutter in einem sehr streng wirkenden Haus lebt und meistens in einer faschistischen Tracht herumläuft. Die Mutter merkt, daß der Junge langsam flügge wird und sie zu verlassen droht. Dies versucht sie zu verhindern. So weit die grundsätzliche Handlung. Dargestellt wird das im Film mit einer Mischung aus traditioneller japanischer Theatertradition, dem europäischen absurden Theater und einigen Ausflügen in den Surrealismus. Man fühlt sich manchmal erinnert an Fellinis Spätwerk und an Jodorowskys wütende Bilderwelten. Und doch wirkt die Darstellung des Menschen bei Terayama merkwürdig verzagt, fast resignativ. Beim Betrachten hatte ich stets den Eindruck, daß ein übermäßig kopflastiger Mensch in seinen Gefühlen herumstochert und etwas verzweifelt ist, daß er so wenig damit anfangen kann, ohne wirklich den Finger auf das persönliche Defizit legen zu können. Dieser Eindruck sollte sich im weiteren Verlauf des Werkes als gegenstandslos erweisen, aber immer langsam. Im direkten Umfeld des Elternhauses, nahe des „Scary Mountain", auf dem nur Ausgestoßene und Orakel zuhause zu sein scheinen, befindet sich auch eine Art japanischer Nationalzirkus, vollgestopft mit Japanflaggen, in dem innerlich wie äußerlich verwachsene Menschen beheimatet sind. Einige von ihnen sind auch getürkt, wie etwa die „Dicke Dame", die in einer aufblasbaren Hülle aus Plastik wohnt, die sie nicht abnehmen darf. Ihr Ehemann, ein Zwerg, pumpt sie regelmäßig auf mit einer kleinen Handpumpe, was ihr Luststöhnen entlockt. Sie hintergeht den Zwerg gelegentlich mit dem Kraftmenschen des Zirkus, der aber schließlich aus Eifersucht die Handpumpe wegwirft. Beide Männer behandeln sie wie den letzten Dreck, was sie aber mit lächelnder Langmut erträgt. Im Zirkus wie außerhalb des Zirkus scheinen die Menschen darauf fixiert zu sein, einander wehzutun, einander zu demütigen.
So weit, so gut. Nach etwa der Hälfte der Laufzeit bricht der Film auf einmal ab und entpuppt sich als Arbeitsmaterial eines Filmregisseurs (=ein Alter Ego Terayamas), der das Werk seinen Investoren zeigt. Er weiß nicht, wie er diesen Film über seine Jugend weiterführen soll, mißtraut seinen eigenen Motiven, seiner Erinnerung. Er taucht in seinen Film ein, betrachtet die verdichtete Welt seiner eigenen Erinnerung. Seine Betrachtungen teilt er mit seinem 20 Jahre jüngeren Selbst, wobei beide Versionen Terayamas an die Grenzen ihres jeweiligen Horizontes stoßen. Der ältere Mann fragt sich, ob er in der Lage ist, die Gegenwart zu verändern, indem er sein fiktives gegenwärtiges Ich seine Mutter im Film umbringen läßt, in dem er sich nun selbst befindet. Ich verrate nicht, ob ihm dies gelingt, aber ich möchte schon einmal andeuten, daß der Film mit einer der außergewöhnlichsten Tee-Szenen der Filmgeschichte endet...
War ich vom Anfang des Filmes nur mäßig beeindruckt, so saß ich gegen Ende völlig baff vor dem Fernseher und staunte Bauklötze. Von Terayama (der ja primär ein Theaterregisseur und Schriftsteller war) hatte ich bislang nur seine beiden französisch koproduzierten „Kommerzfilme" gesehen (FRÜCHTE DER LEIDENSCHAFT mit Kinski und den Episodenfilm COLLECTION PRIVEES) sowie sein extrem schwer zu schluckendes Frühwerk EMPEROR TOMATO KETCHUP, das von dem formenden Einfluß von Politik und Sexualität auf Kinder handelt und in seiner gestalterischen Drastik an Arrabals Aufschrei VIVA LA MUERTE erinnerte. PASTORAL verbindet auf unerhörte Weise die Darstellung einer beschädigten menschlichen Gemeinschaft mit einer Rückführung auf die Wirklichkeitswahrnehmung des Einzelnen. Wie nehmen wir die Gegenwart wahr und wie verläßlich sind unsere Erinnerungen, aus denen sich diese Gegenwartswahrnehmung herleitet? Wie sehr bauen wir selbst an unserer Gegenwart mit? Der autoreflexive Teil von PASTORAL deutet an, daß wir unsere Erinnerungen ständig selbst gestalten, wie ein Künstler, der an seinem Kunstwerk feilt. Aus der Wucht der Erschütterungen, der Verletzungen, ergeben sich all die fiktiven Miniaturen, aus denen sich unser Selbstbild zusammensetzt. Jeder Mensch ist im Grunde ein Künstler, sein Leben ein Kunstwerk, das er nach eigenem Gusto formen kann, wenn die Narben in seinem Gewebe das zulassen. Während Jodorowsky seine surreale Welt mit Grotesken anfüllt, die für meinen Geschmack das Anliegen des Künstlers eher verklausulieren, den Zugang eher erschweren, bleibt Terayama dabei ganz direkt. Er schreckt in einzelnen Szenen nicht einmal davor zurück, seine Poesie aufzuschlüsseln und sich so ganz direkt an sein Publikum zu wenden (z.B. in den Ausführungen des fiktiven Regisseurs über das Zeit-Paradoxon seines Vorhabens oder überhaupt in dessen inneren Monologen). Die Bilder sind ebenfalls direkt, arbeiten vorwiegend mit Formen und Farben, etwa über komplett eingetönte Einstellungen, die die Signalwirkung von Farben verwenden. Die Symbole sind trotz des gequälten Charakters des Menschenbildes eher spielerisch, z.B. die Assoziation von Geschlechtsverkehr mit dem Aufpumpen der Frau mit Luft oder dem Einfangen von Zeit in einer Uhr, die im Elternhaus des jungen Protagonisten aufgrund eines Defektes ständig schlägt. Der Regisseur innerhalb des Filmes gelangt schließlich zu einer Entscheidung. Ob es eine resignative oder eine schöne Entscheidung ist, muß jeder für sich selbst entscheiden. Ich hatte jedenfalls nur anfänglich Angst davor, einer Luftnummer aufzusitzen. PASTORAL halte ich für einen prachtvollen, einen großartigen Film, von dem ich mir sehr wünschen würde, daß ihn jemand in einer angemessenen Form wiederveröffentlicht!