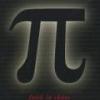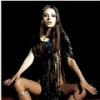„Dad, a table has four corners. If you chop off one corner, how many are left?“
Fugui hat als Sohn eines chinesischen Großgrundbesitzers kein schlechtes Leben. Seine Tage sind geprägt von Alkohl und Glücksspiel. Über diese Freizeitbeschäftigungen vergisst er sogar seine Frau und sein Kind, bis er eines Tages sein gesamtes Vermögen verspielt hat und vor dem Nichts steht. Er muss das ehrwürdige Anwesen der Familie räumen, seine Frau verlässt ihn und er muss von nun an sein Leben als Puppenspieler verdingen.
Die oben angerissene Story bildet nur den Auftakt für einen Ritt durch drei Jahrzehnte chinesische Geschichte. Zhang Yimou begleitet seinen Protagonisten und dessen Familie durch Bürgerkrieg, Kulturrevolution und den „großen Sprung nach vorne“. Der politische Kontext und historische Hintergrund wird dabei bewusst angeschnitten, bleibt aber das, was er für die Menschen im täglichen Kampf ums Überleben darstellt: Rahmenbedingung. Er bestimmt das Leben zwar wie nichts anderes, die Gedanken der Menschen jedoch kreisen um profanere Dinge: wird meine Tochter jemals heiraten? Werden wir den Krieg überleben? oder schlicht und ergreifend: Werden wir heute etwas zu essen haben?
Zhang Yimou verfilmt mit seinem 1994 in Cannes ausgezeichneten Werk „Leben!“ das gleichnamige Buch von Yu Hua. Beide Werke – sowohl Text, als auch Film – waren ursprünglich in China verboten. Obwohl sich der Film weitestgehend an die literarische Vorlage hält, erfuhr er nicht unwesentliche Änderungen. Teilweise rein dramaturgischer Natur – wenn der „gefallene“ Fugui seinen Lebensunterhalt als Schatten-Puppenspieler statt als Bauer verdienen muss – teilweise „politischer“ Natur (Spoiler: bspw. Der Tod des Sohnes und der der Ehefrau).
Alles in allem wirkt „Leben!“ - gerade im Vergleich mit dem Buch – weniger kritisch oder politisch. Zhang Yimou inszeniert seinen Film vielmehr als „Spiel des Lebens“, in dem die Figuren von einem Schicksalsschlag in den nächsten taumeln. Wo im Buch die spärlichen Momente des Glücks nur unheilvolle Boten der nächsten Katastrophe sind, so scheint es hier wirkliche Hoffnung zu geben: Auf ein besseres Leben und auf die Zukunft.
Fugui hat als Sohn eines chinesischen Großgrundbesitzers kein schlechtes Leben. Seine Tage sind geprägt von Alkohl und Glücksspiel. Über diese Freizeitbeschäftigungen vergisst er sogar seine Frau und sein Kind, bis er eines Tages sein gesamtes Vermögen verspielt hat und vor dem Nichts steht. Er muss das ehrwürdige Anwesen der Familie räumen, seine Frau verlässt ihn und er muss von nun an sein Leben als Puppenspieler verdingen.
Die oben angerissene Story bildet nur den Auftakt für einen Ritt durch drei Jahrzehnte chinesische Geschichte. Zhang Yimou begleitet seinen Protagonisten und dessen Familie durch Bürgerkrieg, Kulturrevolution und den „großen Sprung nach vorne“. Der politische Kontext und historische Hintergrund wird dabei bewusst angeschnitten, bleibt aber das, was er für die Menschen im täglichen Kampf ums Überleben darstellt: Rahmenbedingung. Er bestimmt das Leben zwar wie nichts anderes, die Gedanken der Menschen jedoch kreisen um profanere Dinge: wird meine Tochter jemals heiraten? Werden wir den Krieg überleben? oder schlicht und ergreifend: Werden wir heute etwas zu essen haben?
Zhang Yimou verfilmt mit seinem 1994 in Cannes ausgezeichneten Werk „Leben!“ das gleichnamige Buch von Yu Hua. Beide Werke – sowohl Text, als auch Film – waren ursprünglich in China verboten. Obwohl sich der Film weitestgehend an die literarische Vorlage hält, erfuhr er nicht unwesentliche Änderungen. Teilweise rein dramaturgischer Natur – wenn der „gefallene“ Fugui seinen Lebensunterhalt als Schatten-Puppenspieler statt als Bauer verdienen muss – teilweise „politischer“ Natur (Spoiler: bspw. Der Tod des Sohnes und der der Ehefrau).
Alles in allem wirkt „Leben!“ - gerade im Vergleich mit dem Buch – weniger kritisch oder politisch. Zhang Yimou inszeniert seinen Film vielmehr als „Spiel des Lebens“, in dem die Figuren von einem Schicksalsschlag in den nächsten taumeln. Wo im Buch die spärlichen Momente des Glücks nur unheilvolle Boten der nächsten Katastrophe sind, so scheint es hier wirkliche Hoffnung zu geben: Auf ein besseres Leben und auf die Zukunft.