Gefährliche Geliebte (Haruki Murakami)
(1.1.2004 - btb)
 „Wir waren, sie ebenso wie ich, noch fragmentarische Geschöpfe, die gerade erst begannen, die Existenz einer unerwarteten Wirklichkeit zu erahnen, die wir uns noch würden aneignen müssen, die uns ausfüllen und vervollständigen würde. Wir standen vor einer Tür, die wir noch nie zuvor gesehen hatten.“ – So die Worte von Hajime, dem Protagonist und Ich-Erzähler zu Beginn dieser Geschichte. Schon in frühster Kindheit erzählt er, übten Jazz-Platten und das „undefinierte Etwas, das von manchen Angehörigen des anderen Geschlechts ausgeht“ eine besondere Anziehungskraft auf ihn aus. „Die hundertprozentige Frau: Sie hört in diesem Werk auf den Namen Shimamoto und wird sich im Laufe des Romans mehr und mehr als Gefährliche Geliebte erweisen. Vorerst aber ist sie ein zwölfjähriges Mädchen "mit ausdrucksvollen Gesichtszügen" und einem steifen linken Bein; und diese Spätfolge einer Kinderlähmung kann Haruki Murakami eben wirklich so beschreiben, als ob Gehfehler von jeher der Inbegriff der Erotik wären!“ (1) Die beiden werden sich erst zwanzig Jahre später wieder sehen. Er Ende Dreißig, verheiratet, zwei Töchter, und Besitzer eines erfolgreichen Jazzclubs. Sie mysteriös, geheimnisumwoben, ohne Vergangenheit – wie ein Traum aus vergangenen Tagen. Sie erscheint immer an regnerischen Abenden, und weckt mit ihrem süßen Lächeln verloren geglaubte Gefühle…
„Wir waren, sie ebenso wie ich, noch fragmentarische Geschöpfe, die gerade erst begannen, die Existenz einer unerwarteten Wirklichkeit zu erahnen, die wir uns noch würden aneignen müssen, die uns ausfüllen und vervollständigen würde. Wir standen vor einer Tür, die wir noch nie zuvor gesehen hatten.“ – So die Worte von Hajime, dem Protagonist und Ich-Erzähler zu Beginn dieser Geschichte. Schon in frühster Kindheit erzählt er, übten Jazz-Platten und das „undefinierte Etwas, das von manchen Angehörigen des anderen Geschlechts ausgeht“ eine besondere Anziehungskraft auf ihn aus. „Die hundertprozentige Frau: Sie hört in diesem Werk auf den Namen Shimamoto und wird sich im Laufe des Romans mehr und mehr als Gefährliche Geliebte erweisen. Vorerst aber ist sie ein zwölfjähriges Mädchen "mit ausdrucksvollen Gesichtszügen" und einem steifen linken Bein; und diese Spätfolge einer Kinderlähmung kann Haruki Murakami eben wirklich so beschreiben, als ob Gehfehler von jeher der Inbegriff der Erotik wären!“ (1) Die beiden werden sich erst zwanzig Jahre später wieder sehen. Er Ende Dreißig, verheiratet, zwei Töchter, und Besitzer eines erfolgreichen Jazzclubs. Sie mysteriös, geheimnisumwoben, ohne Vergangenheit – wie ein Traum aus vergangenen Tagen. Sie erscheint immer an regnerischen Abenden, und weckt mit ihrem süßen Lächeln verloren geglaubte Gefühle…Ein Buch, das ganz tief in mein Innerstes eingedrungen ist. Kein Wunder – wer ist nicht schon einmal einem ganz besonderen Menschen begegnet, der einen unauslöschlichen Einfluss ausübte, das eigene Leben unwiderruflich veränderte. - „Irgendwann müssen wir erkennen, dass Gefühle soviel maßgeblicher sind als die Ratio, und gleichzeitig, dass Träume manchmal besser solche bleiben sollten.“ – Murakami sinniert über diese Träume, über verpasste Gelegenheiten und das „Was wäre wenn“ – über Liebe im Konjunktiv.
Glitzernde, bunte Neon-Reklametafeln, deren Schein sich auf nassen Straßen spiegelt. Ruhige, regnerische Herbstabende. Sanfter, leiser, hypnotischer Regen. Sanfter, leiser, hypnotischer Jazz. Langsam wird man hinein gesogen in die melancholische, phantastische Welt von Haruki Murakami. Und man kommt nicht mehr davon los, bevor man nicht die letzte Seite umgeblättert hat, bevor nicht das letzte Wort verklungen ist. Und man zurückgelassen wird in einer Trance, in einer ebensolchen unwirklichen Wirklichkeit, in der sich die Protagonisten befinden – und es dauert lange ehe man wieder aufwacht. Schon lange hat mich ein Buch nicht mehr so fasziniert und gefesselt, konnte ich in Worten so versinken. So Abtauchen in Melancholie…
Und damit wären wir beim Grund, warum ich mein „Filmtagebuch“ für solch einen Eintrag „missbrauche“. Sonst passiert mir so etwas nämlich vornehmlich bei Filmen von Wong Kar-Wai, und ein bisschen habe ich mich auch hier an diese erinnert gefühlt: Geheimnisvolle Frauen, mit Regenmänteln und Sonnenbrillen, deprimierte Gestalten, die in Bars rumlungern und Whiskey trinken. – Fehlt nur noch das Verzehren von Ananas.
„Nach all den Jahren ließ mich der bloße Gedanken an Shimamoto noch immer am ganzen Leib erschaudern. Eine leicht fieberhafte Erregung, als stöße ich, irgendwo tief in mir, behutsam eine Tür auf.“ Gefährliche Geliebte (Haruki Murakami)
PS
Japaner scheinen nicht nur fantastische Filme zu drehen, sie schreiben auch gute Bücher. Vielleicht sollte ich es mir zur Lebensaufgabe machen, dieses Werk nochmals im Original zu Lesen. Japanisch lernen kann doch nicht so schwer sein
(1) amazon.de





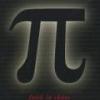




 Cary Grant zum Hundertsten. Dieses mal in einem seiner erfolgreichsten Film: Arsen und Spitzenhäubchen. Eine wunderbare Komödie über nette, alte Damen, deren mörderisches Hobby, und einen verschwundenen Bruder…
Cary Grant zum Hundertsten. Dieses mal in einem seiner erfolgreichsten Film: Arsen und Spitzenhäubchen. Eine wunderbare Komödie über nette, alte Damen, deren mörderisches Hobby, und einen verschwundenen Bruder… China gilt nicht nur als „Land des Lächelns“, sondern auch als „Land der Fahrräder“. Und in keiner anderen Stadt stimmt dieses Bild von überfüllten Straßen, von zig-tausenden von Fahrrädern, die in einem undurchsichtigen Gewusel und Chaos die Stadt überfluten so sehr wie in Beijing. – In diesem schnelllebigen Beijing ist die Geschichte von „Beijing Bicycle“ angesiedelt. Und schon mit der Anfangssequenz, wenn in weichzeichnerischen, verwaschenen, ockerfarbenen Tönen Fahrräder in extremen Closeups und in Zeitlupe durchs Bild rollen, wird eines deutlich: Diese Fahrräder, die so das Bild Beijings bestimmen, und die so alltäglich erscheinen, stellen doch für viele etwas Besonderes dar. Sie sind Symbol ihrer Träume und Hoffnungen. Ikone des Aufbruchs und Synonym für die Chance, für den Weg aus der Armut.
China gilt nicht nur als „Land des Lächelns“, sondern auch als „Land der Fahrräder“. Und in keiner anderen Stadt stimmt dieses Bild von überfüllten Straßen, von zig-tausenden von Fahrrädern, die in einem undurchsichtigen Gewusel und Chaos die Stadt überfluten so sehr wie in Beijing. – In diesem schnelllebigen Beijing ist die Geschichte von „Beijing Bicycle“ angesiedelt. Und schon mit der Anfangssequenz, wenn in weichzeichnerischen, verwaschenen, ockerfarbenen Tönen Fahrräder in extremen Closeups und in Zeitlupe durchs Bild rollen, wird eines deutlich: Diese Fahrräder, die so das Bild Beijings bestimmen, und die so alltäglich erscheinen, stellen doch für viele etwas Besonderes dar. Sie sind Symbol ihrer Träume und Hoffnungen. Ikone des Aufbruchs und Synonym für die Chance, für den Weg aus der Armut.
 Ein Verkehrsunfall im Zentrum der Erzählung. Ein tragischer Vorfall, der das Leben von 3 Personen verändert und ihre Schicksale miteinander verbindet. Wenn mit solch einer Geschichte dann auch noch der Name Alejandro González Iñárritu verbunden ist, dann zucke ich schon ein wenig zusammen und schüttle ungläubig den Kopf. Das habe ich doch schon einmal gesehen – genau genommen vor drei Jahren, als mir der Debütfilm von eben jenem Regisseur den Atem raubte. Was jetzt hier in den Kinos läuft ist leider weniger atemberaubend und lässt mich eher ein wenig enttäuscht zurück…
Ein Verkehrsunfall im Zentrum der Erzählung. Ein tragischer Vorfall, der das Leben von 3 Personen verändert und ihre Schicksale miteinander verbindet. Wenn mit solch einer Geschichte dann auch noch der Name Alejandro González Iñárritu verbunden ist, dann zucke ich schon ein wenig zusammen und schüttle ungläubig den Kopf. Das habe ich doch schon einmal gesehen – genau genommen vor drei Jahren, als mir der Debütfilm von eben jenem Regisseur den Atem raubte. Was jetzt hier in den Kinos läuft ist leider weniger atemberaubend und lässt mich eher ein wenig enttäuscht zurück… Das auffälligste am Film, und vielleicht auch das bemerkenswerteste ist eben diese Auflösung der Zeit. Obwohl sich die Szenen mit Fortschreiten des Films in einen Gesamtzusammenhang einordnen lassen, bleiben sie immer auch (!!) losgelöst von einer narrativen Struktur. Bleiben bloße Stimmungen, Erinnerungen, Momente. Wenn und Aber, vielleicht und eventuell. Jenseits von jeglicher Chronologie befinden sich die Figuren in einem „Dämmerzustand“, in einer Art Trance - …im Konjunktiv.
Das auffälligste am Film, und vielleicht auch das bemerkenswerteste ist eben diese Auflösung der Zeit. Obwohl sich die Szenen mit Fortschreiten des Films in einen Gesamtzusammenhang einordnen lassen, bleiben sie immer auch (!!) losgelöst von einer narrativen Struktur. Bleiben bloße Stimmungen, Erinnerungen, Momente. Wenn und Aber, vielleicht und eventuell. Jenseits von jeglicher Chronologie befinden sich die Figuren in einem „Dämmerzustand“, in einer Art Trance - …im Konjunktiv. Zum Glück tischt uns Iñárritu – entgegen meinen Erwartungen – kein zweites Amores perros auf. Ob er allerdings mit seinem ersten Hollywood-Film etwas Neues geschaffen hat, darüber bin ich mir auch noch nicht ganz im Klaren. Zwar ist die Auflösung der Zeit und der Einsatz von Farben und „Körnung“ interessantes Stilmittel, trotzdem wirkt das ganze wie ein Potpourri aus Altbekanntem, aus Teilen, die man so ähnlich schon einmal irgendwo gesehen hat. Nur alles ein wenig schneller, ein wenig wirrer, um ein, zwei Oktaven gepitcht. Vom Stil her ein extremeres „Amores perros“ (oh je, schon wieder dieser Vergleich), von der Erzählstruktur wie ein zerstückelteres „Pulp Fiction“ und von der Thematik her, wie ein krasseres Magnolia oder Levity. Was dabei herauskommt ist ein dramatisches Puzzle über Trauer und Tod, eine Reflexion über Schuld und Sühne, Vergebung und Sinnsuche. Was davon übrig bleibt ist die Erkenntnis, dass das Leben nur scheinbar linear verläuft, letztendlich eine reine Abfolge von Momenten ist.
Zum Glück tischt uns Iñárritu – entgegen meinen Erwartungen – kein zweites Amores perros auf. Ob er allerdings mit seinem ersten Hollywood-Film etwas Neues geschaffen hat, darüber bin ich mir auch noch nicht ganz im Klaren. Zwar ist die Auflösung der Zeit und der Einsatz von Farben und „Körnung“ interessantes Stilmittel, trotzdem wirkt das ganze wie ein Potpourri aus Altbekanntem, aus Teilen, die man so ähnlich schon einmal irgendwo gesehen hat. Nur alles ein wenig schneller, ein wenig wirrer, um ein, zwei Oktaven gepitcht. Vom Stil her ein extremeres „Amores perros“ (oh je, schon wieder dieser Vergleich), von der Erzählstruktur wie ein zerstückelteres „Pulp Fiction“ und von der Thematik her, wie ein krasseres Magnolia oder Levity. Was dabei herauskommt ist ein dramatisches Puzzle über Trauer und Tod, eine Reflexion über Schuld und Sühne, Vergebung und Sinnsuche. Was davon übrig bleibt ist die Erkenntnis, dass das Leben nur scheinbar linear verläuft, letztendlich eine reine Abfolge von Momenten ist.  Da zappt man nichts ahnend durchs Sonntag-nachmittag-Programm und bleibt bei einem Juwel hängen. – Und das meine ich durchaus wörtlich. Schon lange bin ich nicht mehr so am Fernseher gehangen, habe mit offenem Mund das Geschehen auf der Mattscheibe verfolgt, habe so mitgefiebert, gehofft und gebangt…
Da zappt man nichts ahnend durchs Sonntag-nachmittag-Programm und bleibt bei einem Juwel hängen. – Und das meine ich durchaus wörtlich. Schon lange bin ich nicht mehr so am Fernseher gehangen, habe mit offenem Mund das Geschehen auf der Mattscheibe verfolgt, habe so mitgefiebert, gehofft und gebangt…  „This is the true story of seven strangers, picked to live in a house to find out what happens when people stop being polite and start getting real.“ - „The real world“ heißt eine Reality-Soap, die im Moment auf MTV läuft. 6 Jugendliche aus der ganzen Welt, zusammengewürfelt in einer Stadt. Sich bisher völlig Unbekannte wohnen für einige Monate gemeinsam in einer WG – Sie teilen sich ein Haus, sie arbeiten zusammen, leben zusammen...
„This is the true story of seven strangers, picked to live in a house to find out what happens when people stop being polite and start getting real.“ - „The real world“ heißt eine Reality-Soap, die im Moment auf MTV läuft. 6 Jugendliche aus der ganzen Welt, zusammengewürfelt in einer Stadt. Sich bisher völlig Unbekannte wohnen für einige Monate gemeinsam in einer WG – Sie teilen sich ein Haus, sie arbeiten zusammen, leben zusammen... „Zuerst wirst du so tun, als würdest du sie vergessen, du rufst sie nicht an und das alles, aber dann, irgendwann, dann vergisst du sie wirklich. Und irgendwie schaffen sie es gerade dann zurückzukommen, wenn man sie gerade vergessen hat.“
„Zuerst wirst du so tun, als würdest du sie vergessen, du rufst sie nicht an und das alles, aber dann, irgendwann, dann vergisst du sie wirklich. Und irgendwie schaffen sie es gerade dann zurückzukommen, wenn man sie gerade vergessen hat.“ Der Titel deutet es bereits an: Asiatische Shaolin-Mönche spielen Fußball. Asiatische Kampfkunst meets europäischen Massensport. Eigentlich hätte so was – zumindest bei mir – tierisch in die Hose gehen müssen. Ich mag das Genre des Martial Arts nicht sonderlich und dem deutschen heiligsten Volkssport kann ich nun überhaupt gar nichts abgewinnen. Aber so sehr mich doch diese beiden Dinge für sich genommen abschrecken, so wunderbar funktionieren sie in der Kombination auf der Leinwand. Stephen Chow kombiniert diese beiden „Künste“ in seinem Film wie Ying und Yang. Sie bilden eine gelungene Symbiose und formen einen spaßigen Partyfilm, der darüber hinaus auch den Beweis dafür liefert, dass man Computer-Tricks und CGI-Power durchaus „sinnvoll“ einsetzen kann.
Der Titel deutet es bereits an: Asiatische Shaolin-Mönche spielen Fußball. Asiatische Kampfkunst meets europäischen Massensport. Eigentlich hätte so was – zumindest bei mir – tierisch in die Hose gehen müssen. Ich mag das Genre des Martial Arts nicht sonderlich und dem deutschen heiligsten Volkssport kann ich nun überhaupt gar nichts abgewinnen. Aber so sehr mich doch diese beiden Dinge für sich genommen abschrecken, so wunderbar funktionieren sie in der Kombination auf der Leinwand. Stephen Chow kombiniert diese beiden „Künste“ in seinem Film wie Ying und Yang. Sie bilden eine gelungene Symbiose und formen einen spaßigen Partyfilm, der darüber hinaus auch den Beweis dafür liefert, dass man Computer-Tricks und CGI-Power durchaus „sinnvoll“ einsetzen kann. Kim Ki-Duks Filme sind brutal. Sie sind schonungslos, „hoffnungslos“, wie ein Schlag in die Magengrube. Und das wage ich zu sagen, obwohl – oder gerade weil - ich es noch nicht geschafft habe einen seiner Filme zu Ende zu schauen. Sowohl „The Isle“, als auch „Address Unknown“ stehen weiterhin ungesehen in meinem Regal. Bei keinem Film habe ich es länger als zwanzig Minuten ausgehalten. – Die deprimierende Stimmung und die Ausweglosigkeit, die von den ersten Frames an, im Raum schwingt und die immer weiter anschwillt, sich immer mehr verfestigt und dabei trotzdem gar keine Anstalten macht in irgendeiner Weise zu kulminieren und den Zuschauer zu erlösen: Kim Ki-Duk scheint es zu genießen, den Zuschauer mitleiden zu lassen…
Kim Ki-Duks Filme sind brutal. Sie sind schonungslos, „hoffnungslos“, wie ein Schlag in die Magengrube. Und das wage ich zu sagen, obwohl – oder gerade weil - ich es noch nicht geschafft habe einen seiner Filme zu Ende zu schauen. Sowohl „The Isle“, als auch „Address Unknown“ stehen weiterhin ungesehen in meinem Regal. Bei keinem Film habe ich es länger als zwanzig Minuten ausgehalten. – Die deprimierende Stimmung und die Ausweglosigkeit, die von den ersten Frames an, im Raum schwingt und die immer weiter anschwillt, sich immer mehr verfestigt und dabei trotzdem gar keine Anstalten macht in irgendeiner Weise zu kulminieren und den Zuschauer zu erlösen: Kim Ki-Duk scheint es zu genießen, den Zuschauer mitleiden zu lassen… George Romero zählt zu den ganz Großen. Mit seiner Dead-Trilogie schuf er zweifelsohne Meilensteine des Horror-Genres. Und so mussten nahezu zwangsläufig irgendwann Remakes dieser Werke auftauchen. Von „Night of the Living Dead“ gibt es dieses schon länger. Das Remake zu dem zweiten Teil „Dawn of the Dead“ schafft es nun im Jahre 2004 auf die Leinwand. – 26 Jahre nach der Veröffentlichung des Originals. Dass sich Hollywood so viel Zeit gelassen hat, mag damit zusammenhängen, dass das Original Kultstatus genießt, es eine große Fangemeinde gibt, und folglich viel auf dem Spiel stand. Doch der neue Film schmälert den Mythos des Originals nicht - und das ist durchaus im positiven Sinne zu verstehen. Ich wage gar zu sagen: Das ist das Beste was „Dawn“ hätte passieren können – die 2004er Version ist ein wahrhaft würdiges, respektvolles und innovatives Remake…
George Romero zählt zu den ganz Großen. Mit seiner Dead-Trilogie schuf er zweifelsohne Meilensteine des Horror-Genres. Und so mussten nahezu zwangsläufig irgendwann Remakes dieser Werke auftauchen. Von „Night of the Living Dead“ gibt es dieses schon länger. Das Remake zu dem zweiten Teil „Dawn of the Dead“ schafft es nun im Jahre 2004 auf die Leinwand. – 26 Jahre nach der Veröffentlichung des Originals. Dass sich Hollywood so viel Zeit gelassen hat, mag damit zusammenhängen, dass das Original Kultstatus genießt, es eine große Fangemeinde gibt, und folglich viel auf dem Spiel stand. Doch der neue Film schmälert den Mythos des Originals nicht - und das ist durchaus im positiven Sinne zu verstehen. Ich wage gar zu sagen: Das ist das Beste was „Dawn“ hätte passieren können – die 2004er Version ist ein wahrhaft würdiges, respektvolles und innovatives Remake… Ziemlich genau ein halbes Jahr nach dem
Ziemlich genau ein halbes Jahr nach dem  Die ersten Aufnahmen der New Yorker Skyline muten an, wie auf einem Foto von Henri Silberman. Schwarz-Weiße Straßenschluchten, Brücken, die sich bis ins Unendliche zu erstrecken scheinen. Tausende funkelnde Lichter und tief schwarzes Nichts zugleich. Und inmitten dieser Weiten der urbanen Anonymität ein einsamer, trauriger Mann. Er steht in Gedanken oder Erinnerungen verloren auf der Brooklyn Bridge und schaut hinaus in die Weite, die ins Nirgendwo zu führen scheint. Er dreht sich langsam und, und wird vom Dunkel verschlungen.
Die ersten Aufnahmen der New Yorker Skyline muten an, wie auf einem Foto von Henri Silberman. Schwarz-Weiße Straßenschluchten, Brücken, die sich bis ins Unendliche zu erstrecken scheinen. Tausende funkelnde Lichter und tief schwarzes Nichts zugleich. Und inmitten dieser Weiten der urbanen Anonymität ein einsamer, trauriger Mann. Er steht in Gedanken oder Erinnerungen verloren auf der Brooklyn Bridge und schaut hinaus in die Weite, die ins Nirgendwo zu führen scheint. Er dreht sich langsam und, und wird vom Dunkel verschlungen. - Loving You (ep 1)
- Loving You (ep 1)
 Tigerland – ein „Miniatur-Vietnam“ der US-Armee. In diesem Ausbildungslager werden in den 70ern tausende junge Männer auf den realen Einsatz im Feindesland vorbereitet. Sie werden von den Ausbildern gnadenlos gedrillt und gedemütigt. Die Rekruten gehen mit dem Stress auf unterschiedlichste Weise um: „Der sensible Paxton hasst den Krieg, möchte aber als überzeugter Patriot für sein Land kämpfen. Zugführer Miter will seine Männlichkeit unter Beweis stellen.“ Und der aggressive Wilson brennt darauf in den Krieg zu ziehen. Einzig der Rebell Bozz geht aktiv gegen das System vor. Er legt sich mit seinen Vorgesetzten an, wo es nur geht und handelt sich mit seiner Respektlosigkeit jede Menge Ärger ein.
Tigerland – ein „Miniatur-Vietnam“ der US-Armee. In diesem Ausbildungslager werden in den 70ern tausende junge Männer auf den realen Einsatz im Feindesland vorbereitet. Sie werden von den Ausbildern gnadenlos gedrillt und gedemütigt. Die Rekruten gehen mit dem Stress auf unterschiedlichste Weise um: „Der sensible Paxton hasst den Krieg, möchte aber als überzeugter Patriot für sein Land kämpfen. Zugführer Miter will seine Männlichkeit unter Beweis stellen.“ Und der aggressive Wilson brennt darauf in den Krieg zu ziehen. Einzig der Rebell Bozz geht aktiv gegen das System vor. Er legt sich mit seinen Vorgesetzten an, wo es nur geht und handelt sich mit seiner Respektlosigkeit jede Menge Ärger ein.  Und noch bevor die virtuos inszenierte erste Sequenz über den Bildschirm flimmert, lief es mir eiskalt den Rücken herunter und stellten sich die Nackenhaare auf. Die von Carpenter selbst komponierte, minimalistische Theme lässt den Schrecken und Horror schon ohne visuelle Unterstützung langsam aber beständig aus dem Fernseher kriechen. Die bereits ins Gemeingut eines jeden Cineasten eingegangenen Akkorde lassen schlimmes erahnen. Noch bevor die ersten Bilder zu sehen sind schwebt der Finger abwechselnd zitternd über Pause und Vorspul-Taste. – Das ambivalente Tremble zwischen Neugierde und Angst wird auf die Spitze getrieben, als man Michael aus der Egoperspektive ums Haus schleichen sieht. – Generell ein sehr schönes Stilmittel, dass man den „schwarzen Mann“ selten frontal zu sehen bekommt. Aber nicht nur der Protagonist wird selten gezeigt - generell gibt es wenig explizite Szenen zu sehen, der Gore-Faktor ist minimal. Dafür steigert sich der Suspence in Hitchcocksche Sphären. Am Ende erst einmal alle Lichter im Haus angemacht und Baldrian geschluckt. Es ist nur ein Film… Nur ein Film…
Und noch bevor die virtuos inszenierte erste Sequenz über den Bildschirm flimmert, lief es mir eiskalt den Rücken herunter und stellten sich die Nackenhaare auf. Die von Carpenter selbst komponierte, minimalistische Theme lässt den Schrecken und Horror schon ohne visuelle Unterstützung langsam aber beständig aus dem Fernseher kriechen. Die bereits ins Gemeingut eines jeden Cineasten eingegangenen Akkorde lassen schlimmes erahnen. Noch bevor die ersten Bilder zu sehen sind schwebt der Finger abwechselnd zitternd über Pause und Vorspul-Taste. – Das ambivalente Tremble zwischen Neugierde und Angst wird auf die Spitze getrieben, als man Michael aus der Egoperspektive ums Haus schleichen sieht. – Generell ein sehr schönes Stilmittel, dass man den „schwarzen Mann“ selten frontal zu sehen bekommt. Aber nicht nur der Protagonist wird selten gezeigt - generell gibt es wenig explizite Szenen zu sehen, der Gore-Faktor ist minimal. Dafür steigert sich der Suspence in Hitchcocksche Sphären. Am Ende erst einmal alle Lichter im Haus angemacht und Baldrian geschluckt. Es ist nur ein Film… Nur ein Film… Wer kennt es nicht, dieses Gefühl der Wut, der Trauer und der Angst. Die Zeit nach einer gescheiterten Beziehung vereint alle diese dem Menschen verhassten Gefühle in einem Moment. Und jedes Mal auf Neue möchte man diese Zeitspanne, und vor allem die Zeit davor am liebsten vergessen. Möchte die Erinnerungen an die damals noch so schönen, sonnigen Zeiten einfach aus dem Gedächtnis tilgen. Jeder Gedanke führt unwillkürlich auf sie zurück. Die Erinnerung wird zur Qual. In „Vergiss mein nicht!“, dem neuen Film von Michel Gondry, ist der „Wunschtraum“ des Vergessens Wirklichkeit geworden. Wenn der Liebeskummer zu stark auf die Seele drückt, vereinbart man eben mal schnell einen Termin beim Onkel Doktor und am nächsten Tag sind die unliebsamen Erinnerungen ausgelöscht. Eben diesen Weg beschreitet Joel, der so seine verflossene Clementine vergessen will. Doch das Vergessen ist gar nicht so einfach, „und als sich Joel nach seinem Eingriff erneut in Clementine verliebt, ist endgültig klar, dass er diese Frau niemals aus dem Kopf kriegen wird...“
Wer kennt es nicht, dieses Gefühl der Wut, der Trauer und der Angst. Die Zeit nach einer gescheiterten Beziehung vereint alle diese dem Menschen verhassten Gefühle in einem Moment. Und jedes Mal auf Neue möchte man diese Zeitspanne, und vor allem die Zeit davor am liebsten vergessen. Möchte die Erinnerungen an die damals noch so schönen, sonnigen Zeiten einfach aus dem Gedächtnis tilgen. Jeder Gedanke führt unwillkürlich auf sie zurück. Die Erinnerung wird zur Qual. In „Vergiss mein nicht!“, dem neuen Film von Michel Gondry, ist der „Wunschtraum“ des Vergessens Wirklichkeit geworden. Wenn der Liebeskummer zu stark auf die Seele drückt, vereinbart man eben mal schnell einen Termin beim Onkel Doktor und am nächsten Tag sind die unliebsamen Erinnerungen ausgelöscht. Eben diesen Weg beschreitet Joel, der so seine verflossene Clementine vergessen will. Doch das Vergessen ist gar nicht so einfach, „und als sich Joel nach seinem Eingriff erneut in Clementine verliebt, ist endgültig klar, dass er diese Frau niemals aus dem Kopf kriegen wird...“ „Brooklyn Cigar“, der kleine, unscheinbare Tabakladen in Brooklyn. Das ist die Welt in die uns Paul Auster und Wayne Wang entführt. Doch hier werden nicht nur Glimmstängel verkauft, hier treffen Charaktere aufeinander, die alle eine Geschichte zu erzählen haben. Und so ist dieser Mikrokosmos eher eine Begegnungsstätte als nur ein Tabakladen. Ist Besitzer Auggie nicht nur Verkäufer, sondern Beobachter und Geschichtenerzähler. Genauso wie wir in diesem Film immer weniger Zuschauer, als viel mehr zum Zuhörer werden. Wir erleben Depression und Inspiration. Wir werden Zeugen ungewöhnlicher Freundschaften und Begegnungen. Da ist zum Beispiel der Schriftsteller Paul Benjamin, dessen Frau erschossen wurde und der seither keinen Satz mehr zu Papier bringt. Oder der schwarze Jugendliche Rashid, der auf der Suche nach seinem Vater ist…
„Brooklyn Cigar“, der kleine, unscheinbare Tabakladen in Brooklyn. Das ist die Welt in die uns Paul Auster und Wayne Wang entführt. Doch hier werden nicht nur Glimmstängel verkauft, hier treffen Charaktere aufeinander, die alle eine Geschichte zu erzählen haben. Und so ist dieser Mikrokosmos eher eine Begegnungsstätte als nur ein Tabakladen. Ist Besitzer Auggie nicht nur Verkäufer, sondern Beobachter und Geschichtenerzähler. Genauso wie wir in diesem Film immer weniger Zuschauer, als viel mehr zum Zuhörer werden. Wir erleben Depression und Inspiration. Wir werden Zeugen ungewöhnlicher Freundschaften und Begegnungen. Da ist zum Beispiel der Schriftsteller Paul Benjamin, dessen Frau erschossen wurde und der seither keinen Satz mehr zu Papier bringt. Oder der schwarze Jugendliche Rashid, der auf der Suche nach seinem Vater ist… Meilenweit entfernt von ihrem vorherigen Film “Italienisch für Anfänger” und doch so ähnlich…
Meilenweit entfernt von ihrem vorherigen Film “Italienisch für Anfänger” und doch so ähnlich…  The Duel Project – ein Film-Projekt, bei dem zwei Regisseure aufeinander treffen. Sie stehen sich, genauso wie ihre Protagonisten gegenüber. Mann gegen Mann, der klassische Zweikampf. Die Regeln: Sieben Tage Drehzeit, die Beschränkung auf einen einzigen Handlungsort, die Handlung: Ein Duell bis zum Tod. Alle anderen Parameter sind den Regisseuren frei überlassen. Ryuhei Kitamura siedelt seine Realisierung dieser Vorgaben in dem typischen, klassischen japanischen Genre des Samuraifilms an.
The Duel Project – ein Film-Projekt, bei dem zwei Regisseure aufeinander treffen. Sie stehen sich, genauso wie ihre Protagonisten gegenüber. Mann gegen Mann, der klassische Zweikampf. Die Regeln: Sieben Tage Drehzeit, die Beschränkung auf einen einzigen Handlungsort, die Handlung: Ein Duell bis zum Tod. Alle anderen Parameter sind den Regisseuren frei überlassen. Ryuhei Kitamura siedelt seine Realisierung dieser Vorgaben in dem typischen, klassischen japanischen Genre des Samuraifilms an.









